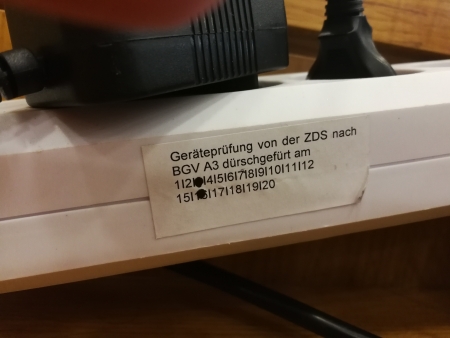Gleich zwei Durchsuchungen in zwei Wochen – das schafft auch nicht jeder. Meinem Mandanten gelang genau dies im Spätsommer. Da war es heiß. Unerträglich heiß. Und offensichtlich schlug dieses widrige Wetter der zuständigen Staatsanwältin und einer Richterin etwas auf die Urteilsfähigkeit…
Zunächst wurde die Wohnung meines Mandanten durchsucht. Da war er sogar nur Zeuge. Weshalb die Polizei auch das Handy meines Mandanten nicht einsackte, Stichwort Verhältnismäßigkeit. Vielmehr schaute ein Beamter das Handy sorgfältig durch. Da er weder verdächtige Mails noch Chats entdeckte, kriegte mein Mandant an Ort und Stelle sein Telefon wieder.
Zwei Wochen später wurde mein Mandant dann zum Beschuldigten. Und zwar in einer Vernehmung als Zeuge, in der er nicht so bereitwillig gegen andere Beschuldigte aussagte, wie es die Staatsanwältin gerne gehabt hätte. Die Staatsanwältin machte meinen Mandanten nach kurzer Bedenkpause nicht nur zum Beschuldigten. Sie erwirkte bei der Ermittlungsrichterin auch einen Durchsuchungsbeschluss. Inhalt: sofortige Sicherstellung des Handys meines Mandanten, weil sich auf diesem verdächtige Mails und Chats befinden könnten, die aus der Zeit vor der ersten Durchsuchung stammen.
Grund genug nun für das Landgericht als Beschwerdeinstanz, die Staatsanwältin und die Richterin an juristische Prinzipien zu erinnern. Zuvörderst natürlich jene des logischen Denkens. Wenn das Handy schon mal polizeilich überprüft worden ist, spricht erst mal wenig dafür, dass sich nun Daten aus der Zeit vor dieser Überprüfung darauf befinden, die zum Zeitpunkt der ersten Durchsuchung nicht auch schon drauf waren. Jedenfalls, so das Landgericht, bräuchte man dann zumindest belastbare Anhaltspunkte für einen Fehler des eingesetzten Polizeibeamten. Oder Indizien, dass eben ältere Daten nachträglich auf das Handy gelangt sind, aus welchem Grund auch immer.
Ich hoffe mal, man geht die Ermittlungen jetzt mit etwas kühlerem Kopf an. Die meteorologischen Voraussetzungen liegen ja mittlerweile vor.