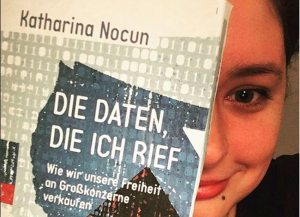Im Heilbronner Prozess gegen eine 70-jährige „Ersatzoma“, die einen Siebenjährigen getötet haben soll, möchte das Gericht die Angeklagte zu einer Aussage bewegen. Hierzu ermöglichten die Richter sogar ein dreistündiges Gespräch zwischen der inhaftierten Frau und ihrem Sohn, das nicht überwacht wurde. Von Erfolg ist diese Strategie noch nicht gekrönt – bislang hat die Frau sich nicht zur Sache geäußert.
Den Stand der Dinge fasst Spiegel Online so zusammen:
Doch die bisherigen Verhandlungstage zeigten: Ohne eine Einlassung der Angeklagten ist die Aufklärung schwierig. Nur Elisabeth S. kennt die Wahrheit. Nur sie kann berichten, was am Abend des 27. April vergangenen Jahres oder in der darauffolgenden Nacht in ihrem Haus in Künzelsau passiert ist, als Ole in ihrer Obhut war.
Da ist es natürlich nachvollziehbar, wenn ein Gericht alle Register zieht, um die Angeklagte zum Sprechen zu bringen. Ein unüberwachtes Gespräch mit einem nahen Angehörigen ist juristisch sicherlich nicht üblich, aber auch nicht verboten. Die Regeln für die Untersuchungshaft sind so gestaltet, dass Beschränkungen – etwa im Umgang mit Besuchern – besonders angeordnet sein müssen. Beschränkungen können auch jederzeit aufgehoben werden. Darüber entscheidet allein das Gericht.
Die Strafkammer hatte also ohne weiteres die Kompetenz, den Sohn unbeaufsichtigt mit seiner Mutter sprechen zu lassen. Das juristische Risiko aus Sicht der Verteidigung ist dabei allerdings gar nicht so klein. Denn wenn sich die Frau gegenüber ihrem Sohn möglicherweise geöffnet und den Hergang der Ereignisse geschildert hat, könnte der Sohn sich dazu entschließen, gegen seine Mutter auszusagen. Er muss es zwar nicht, er darf es aber.
Als Verteidiger muss man überdies solche Signale des Gerichts zu deuten wissen – im Interesse des eigenen Mandanten. Je mehr deutlich gemacht wird, dass eine Aufklärung ohne Mitwirkung des Angeklagten nicht möglich ist, desto größer ist faktisch die Chance, dass der Tatnachweis nicht gelingen wird. Denn kein Gericht läuft hinter dem Angeklagten her, wenn es diesen auch ohne seine Mitwirkung verurteilen kann.
Das alles läuft dann auf den Grundsatz „in dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten, hinaus. Es würde mich deshalb nicht wundern, wenn die Angeklagte letztlich auch nicht dem psychiatrischen Sachverständigen sagt, was sich zugetragen hat. Dass die Verteidigerin das jetzt erst mal vage in Aussicht stellt, kann auch reine Taktik sein. Bis zum Gespräch mit dem Sachverständigen kann es sich die Angeklagte ja jederzeit wieder anders überlegen.