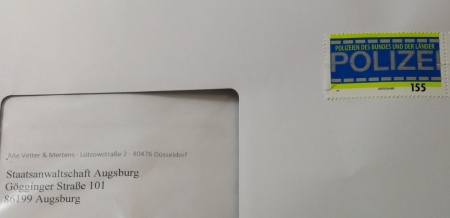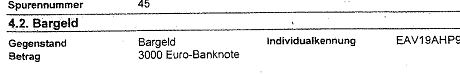Kleine Schusseligkeiten können sich ganz schön potenzieren. Wie eine Pflichtverteidigerabrechnung, die ich bei Gericht eingereicht habe. Bei der Abrechnung habe ich übersehen, dass sich mein Mandant in Untersuchungshaft befindet. Zwar nicht in dieser konkreten Angelegenheit, aber das spielt keine Rolle. Nach dem Vergütungsgesetz kommt es für den sogenannten Haftzuschlag nur darauf an, dass Untersuchungshaft vollzogen wird.
Den betreffenden Zuschlag habe ich leider nicht mitberechnet. Das macht in dem Fall einen Unterschied von 72,59 €, immerhin etwa 15 % des Gesamthonorars. Also nun kein Minimalbetrag, den ich jetzt achselzuckend abschreiben würde.
Leider gibt es da noch eine Kleinigkeit, deshalb erzähle ich die Geschichte. Bei den Fällen handelt es sich um Taten aus einer mutmaßlichen Betrugsserie, insgesamt 27 Stück. Ich wurde vor Verbindung der einzelnen Angelegenheiten als Pflichtverteidiger beigeordnet. Und zwar in allen 27 Fällen. Das bedeutet, ich habe die unvollständige Abrechnung nicht nur einmal eingereicht, sondern 27 Mal. Leider ist mir das auch erst aufgefallen, als das Gericht die ersten Rechnungen samt und sonders gezahlt hat.
Wenn ich nicht auf das Honorar verzichten will, muss ich jetzt also die 72,59 € hochoffiziell nachmelden – 27 Mal. Ich werde mal schauen, wie ich mich bei der zuständigen Rechtspflegerin für die unnötige Arbeit entschuldigen kann. Vielleicht am besten persönlich, wenn ich nächste Woche wieder an dem betreffenden Gericht bin.