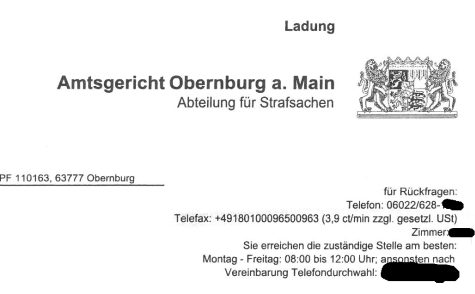Meine Mandantin hatte das schöne Erlebnis einer Hausdurchsuchung. Ihr einziges Vergehen: Sie hat jemanden nicht zurückgerufen. Hätte sie zurückgerufen, wäre sie aber erst recht nicht von einer Hausdurchsuchung verschont geblieben. Sozusagen eine lose-lose Situation, und zwar eine erster Güte.
Passiert ist folgendes. In Hessen ermittelt eine Sonderkommission gegen türkische Verdächtige, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und Senioren um ihre Barschaft bringen. Bei den Ermittlungen wurde eine Handynummer überwacht. Allerdings weiß man nicht, wer das Handy am fraglichen Tag genutzt hat. Fest steht nur, dass der damalige Nutzer („unbekannte männliche Person, UmP“) an einem Spätsommertag im Jahr 2018 auf einer Handynummer angerufen hat, die auf meine Mandantin registriert ist.
Das Gespräch verlief eher einseitig. Die UmP soll zu ihrer Gesprächspartnerin („unbekannte weibliche Perso, UwP“) gesagt haben, diese solle sich schnellstmöglich auf der angezeigten Nummer melden. Aus dem Gesprächsinhalt lässt sich schließen, dass die weibliche Stimme die türkischsprachige Mobilfunkansage bei Nichterreichbarkeit gewesen sein dürfte, die meine Mandantin seinerzeit über ihren Provider aktiviert hatte. Denn jemanden, der drangeht, um schnellstmöglichen Rückruf zu bitten, macht jetzt ja nicht unbedingt Sinn. Ich kann in diesem Punkt derzeit aber auch nur spekulieren, denn die Audio-Datei haben die hessischen Beamten ebenso wenig an ihre Kollegen in NRW weitergeleitet wie ein Wortprotokoll des Anrufs.
Sich für solche unbedeutenden Details interessiert hat sich hier in NRW aber bislang auch niemand.
Fakt ist jedoch, das mutmaßlich sehr einseitige „Gespräch“ hat stolze 18 Sekunden gedauert, und neben dem „Rückruf“ gab es kein anderes Thema. Fakt ist weiter, meine Mandantin oder der tatsächliche Nutzer ihres Handys haben nicht zurückgerufen. Am Folgetag wiederholte sich das Spiel noch mal. Wiederum kein Rückruf. Anzeichen für ein Gespräch zu irgendeinem Thema: null.
Was die hessischen Kommissare aber nicht daran hindert zu spekulieren, der Anruf von der überwachten Rufnummer könne ja dazu gedient haben, meine türkischstämmige Mandantin als Helferin bei einem Polizeitrick anzuwerben. Oder, noch schlimmer, meine Mandantin stecke mit der Gang längst unter einer Decke.
Die Akte füllte sich dann mit einigen weiteren Spekulationen und Mutmaßungen. Die gravierendste Erkenntnis dürfte sein, dass gegen meine Mandantin vor drei Jahren mal wegen Unfallflucht nach einem Bagatellunfall ermittelt wurde. Aber hey, irgendwie findet sich immer ein Richter, der sein Autogramm auch unter solch einen windigen Durchsuchungsantrag setzt. Gefunden wurde bei der Durchsuchung letztlich nichts. Weder in der Wohnung noch auf (allen) elektronischen Geräten der Mandantin.
Dass der Anrufer sich verwählt haben könnte, kam übrigens niemanden in den Sinn.