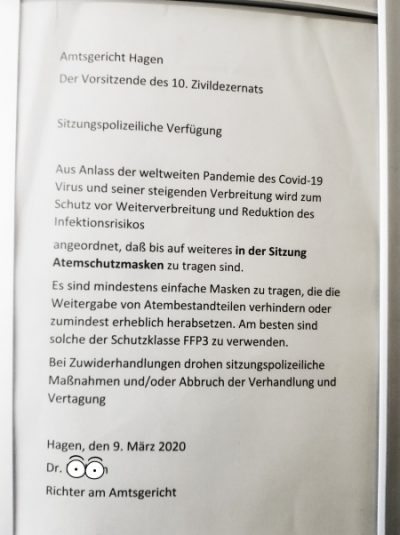Auf Grund der strengen behördlichen Anweisungen in Zeiten der Coronakrise finden momentan so gut wie keine kulturellen oder sonstigen Veranstaltungen mehr statt. Fällt die einmalige Veranstaltung, zum Beispiel ein Konzert oder Theaterstück, aus, kann man vom Veranstalter den Ticketpreis zurückverlangen. Insoweit ist die Rechtslage klar.
Wie sieht es aber bei Mitgliedschaften mit Laufzeit aus, zum Beispiel im Fitnessstudio oder beim Kochkurs? Diese sind ja auch vom Shutdown betroffen, der sich wohl heute noch einmal verschärfen wird.
Juristisch gilt Folgendes: Pausiert die Mitgliedschaft notgedrungen, handelt sich auch ohne Verschulden des Anbieters um einen Fall der sogenannten „Unmöglichkeit“ (§ 275 BGB). Da KundInnen nicht für diese Unmöglichkeit verantwortlich sind, entfällt der Anspruch der Betreiber auf Zahlung (§ 326 BGB).
Das sehen Anbieter natürlich eher ungerne und kommen auf kreative Ideen. Die bundesweit größte Fitnesskette RSG Group (McFit, John Reed) hat bereits ein Statement veröffentlicht. Danach soll die gesamte Dauer der jetzigen Schließung am Ende der Mitgliedschaft beitragsfrei ersetzt werden. Mit anderen Worten: Der Kunde soll den jetzigen Ausfall erst einmal selbst tragen und kriegt am Ende den zeitlich entsprechenden Beitrag erlassen. McFit will sich die Krisenkosten also vom Kunden stunden lassen. Darauf kann man sich einlassen, muss es aber nicht, denn auch für Fitnessclubs gelten die klaren gesetzlichen Regeln, die da lauten: „Kein Geld ohne Leistung.“
Für den Kunden bedeutet so ein Vorschlag nun zusätzlichen Aufwand. Er muss sich beim Studio beschweren und auf anteilige Erstattung pochen. Wer weniger Lust auf nervige Diskussionen hat und die Sache nicht aus den Augen verlieren will, kann jeweils am Monatsende zu viel abgebuchte Beiträge bei der Bank zurückbelasten lassen. Das geht im Lastschriftverfahren problemlos. Und das Studio dürfte schon ahnen, warum zurückgebucht wird.
Einen kundenfreundlicheren Weg geht beispielsweise der Urban Sports Club, über den man in einer Vielzahl von Studios trainieren kann. Kunden können dort mit sofortiger Wirkung eine Corona-Pause aktivieren. Der Urban Sports Club sagt zu, dass nichts bezahlt werden muss, so lange in der Region des Kunden die Sportstudios behördlich geschlossen sind.
Vertragspause ist ohnehin ein gutes Stichwort. Genau diese Vertragspause sehen nämlich mittlerweile viele Sportstudios vor, um im Wettbewerb bestehen zu können. Gut möglich also, dass sich im Kleingedruckten ein eleganter Weg versteckt, um ohne großen Begründungsaufwand nicht mit den monatlichen Kosten belastet zu werden.
Auch bei Dauerkarten, etwa für den Fußball, gilt das oben Gesagte. Man kann das gezahlte Geld für die Saison anteilig zurückverlangen, wenn bestimmte Spiele nicht stattfinden. So sieht es auch die Verbraucherzentrale.
Allerdings: Gerade bei Veranstaltungen aus dem Kleinkunstbereich oder beim inhabergeführten Sportstudio um die Ecke kann man sich auch überlegen, ob man das bereits gezahlte nicht lieber als Investition in die hoffentlich rosige Zukunft sieht, indem man etwas finanziellen Druck von den Anbietern nimmt. Dabei sollte man aber auch ins Auge fassen, ob die betreffenden Unternehmen auch ihren oftmals „freien“ und nun beschäftigungslosen Mitarbeitern (z.B. Trainer, Servicekräfte) angemessen unter die Arme greifen. RAin Jennifer Leopold