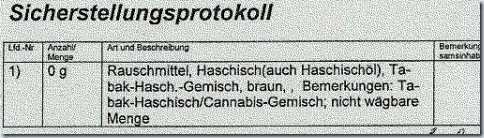Am Kölner Justizzentrum gibt es einen Parkplatz für Anwälte. Das ist sehr praktisch. Wenn man Anwalt ist. Ich bin oft in Köln und pflege deshalb traditionell ein gutes Verhältnis zu den knuffigen Herren, die bis zum späten Vormittag Aufsicht führen. Ein kleiner Plausch, aber vor allem ein Trinkgeld hier und da führen jedenfalls dazu, dass sich selbst an betriebsamen Tagen ganz hinten rechts noch eine Lücke findet. Auch wenn der Kollege mit dem verkniffenen Gesicht vorher mit höchstem Bedauern abgewiesen wurde.
Wo Juristen parken, sind Rechtsfragen natürlich nicht weit. So berichtet mir ein Referendar, dass er jüngst nicht auf den Kölner Anwaltsparkplatz fahren durfte. Und das, obwohl er doch nachweislich als offizieller Vertreter des Rechtsanwalts zu einer Verhandlung anreiste, bei dem er sich gerade ausbilden lässt. Sogar die Untervollmacht des Anwalts ließ die Parkaufsicht unbeeindruckt.
Das ist schon interessant. Vor Gericht gilt der Referendar als vollwertiger Vertreter des Anwalts, aber für den Anwaltsparkplatz reicht sein Status nicht. Ein Wörtchen hat wohl auch der Kölner Anwaltverein mitzureden. Nach Auskunft des Parkwächters kommt es nämlich gar nicht auf die Frage an, ob Referendar oder nicht. Es dürften nämlich ohnehin nur Rechtsanwälte auf den Parkplatz, die Mitglied im Kölner Anwaltverein sind. Womit der Referendar aus dem Renne wäre.
Ich bin jedenfalls beruhigt, dass ich nach wie vor – wie vorgestern getestet – offenbar unbesehen als Mitglied des Kölner Anwaltvereins durchgehe. Und das, obwohl ich mein Düsseldorfer Autokennzeichen bei der Anfahrt nicht extra verhülle.