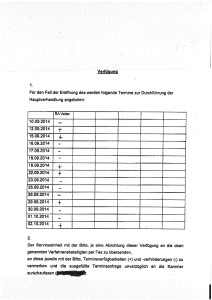Baustellen sind nervig. Für einen Tankstellenbesitzer in Sachsen-Anhalt auch teuer. Denn wegen einer fünfmonatigen Sperrung der B 184 wegen Brückenarbeiten machte er deutlich schlechtere Geschäfte. Trotzdem kriegt er vom Land Sachsen-Anhalt kein Geld.
Vor Gericht hatte der Tankstellenbetreiber 60.000 Euro eingeklagt. Für fünf Monate war seine Tankstelle in Greppin zwar erreichbar, lag wegen der Totalsperrung im weiteren Verlauf aber in einer Sackgasse.
Das Bundesfernstraßengesetz (§ 8a Absatz 5) sieht zwar eine Entschädigung bei längeren Bauarbeiten vor. Voraussetzung ist aber, dass die wirtschaftliche Existenz des Betriebes bedroht ist.
Hierfür muss nach Auffassung des Landgerichts Magdeburg Zahlungsunfähigkeit und damit letztlich die Pleite drohen. Das konnte der Tankstellenbetreiber aber nicht belegen. Vielmehr habe er, so das Gericht, nach den vorgelegten Unterlagen ausreichendes Betriebskapital und Barmittel gehabt.
Das Oberlandesgericht Naumburg hat die Entscheidung jetzt bestätigt (Aktenzeichen 6 U 33/13).