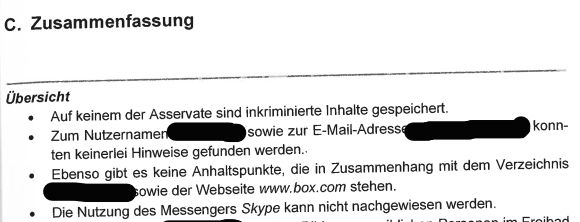Homepage abgeschaltet, sieben Gebäude durchsucht und Vermögenswerte von bis zu 1,4 Millionen Euro arrestiert: Die bayerische Justiz hat heute zu einem großen Schlag gegen die Letzte Generation ausgeholt. Der Vorwurf lautet nicht mehr auf Nötigung bei Klimablockaden, jetzt geht es um die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist eine Begrifflichkeit, die man sonst eher bei Drogenhandel, Mafia, Clans und Wirtschaftskriminalität verortet. Ob organisierte Klimakleber juristisch in diesen Sphären schweben, ist längst nicht ausgemacht.
Bei der Frage nach der kriminellen Vereinigung dreht sich alles um den § 129 StGB. Dessen zweiter Absatz ist eigentlich recht verständlich:
Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.
Das passt in seiner Allgemeinheit auch auf Gesangsvereine. Deshalb bleiben im Kern nur zwei Punkte an anderer Stelle des Gesetzes, welche die Letzte Generation von einer Einstufung als kriminelle Vereinigung bewahren können:
1. Der Zweck der Vereinigung muss auf die Begehung von Straftaten gerichtet sein. Dieser Punkt wird sicher intensiv diskutiert werden. Die Letzte Generation verfolgt den Ansatz, mit ihren Blockadeaktionen Aufmerksamkeit zu erregen, um Politik und Gesellschaft insgesamt zur Rettung des Weltklimas aufzurütteln. Straftaten wie die Nötigung im Straßenverkehr könnte man damit auch als reines Mittel zum Zweck bewerten – und eben nicht als primäres Anliegen. Allerdings wird hier auch eine Rolle spielen, dass die Letzte Generation mutmaßlich schon mit Millionenbeträgen unterstützt wurde. Das spricht für eine doch eher wilde Entschlossenheit auch zu Straftaten. Diese Entschlossenheit spiegelt sich auch in den Handlungen von den Wiederholungstätern unter den Aktivisten, die sich nach einer Verurteilung sofort wieder festkleben.
Die juristische Meinungsskala ist bei all diesen Punkten in alle Richtungen offen. Letztlich ist es wie so oft eine reine Wertungsfrage in einer komplizierten Gemengelage von Staatswohl und Grundrechten. Das letzte Wort wird mit einiger Sicherheit erst vom Bundesverfassungsgericht gesprochen.
2. Höchst umstritten ist die zweite Voraussetzung für eine kriminelle Vereinigung. Es geht um die sogenannte Erheblichkeitsschwelle. Bejaht man dieses Erfordernis (was nach diversen Gesetzesänderungen und im Licht des Europarechts fraglich ist), müssten die Aktivitäten der Vereinigung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Ob bloße punktuelle Straßenblockaden, so sehr sie auch einzelne im Stau treffen mögen, wirklich darunter fallen? Wie das letztlich abgewogen wird, ist ebenfalls nicht absehbar.
Den Strafverfolgern muss damit klar sein, dass sie ein erhebliches Risiko eingehen. Bestätigt sich dereinst der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung nicht, heißt es, hier wurde mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Oder gar die Grundlage für terroristische Organisationsstrukturen gelegt. Denn mit der heutigen Maßnahme ist ja klar, dass es künftig auch den Organisatoren, (stillen) Helfern und vor allem auch den Finanziers an den Kragen gehen kann.
Endlich zeigt der Rechtsstaat Zähne, werden sich viele freuen. Aber die vorläufige Ächtung der Letzten Generation als kriminelle Vereinigung ist aus umgekehrter Sicht auch so was wie eine Heiligsprechung. Vielleicht wäre es besser gewesen, Nötigung einfach weiter als Nötigung zu bestrafen.