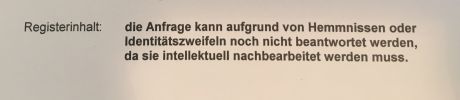Ein neuer Mandant wurde bisher von einem anderen Rechtsanwalt vertreten. Doch zwischen Anwalt und Mandant kam es zu einem Streit. Ursache des Ärgers: Der bisherige Anwalt hatte zwar Einsicht in die Strafakte genommen. Er weigerte sich aber kategorisch, dem Mandanten eine Kopie der Akte zu geben. Das wiederum wollte der Mandant sich nicht gefallen lassen…
Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass dies wirklich der tragende Grund für den Streit war. Also telefonierte ich erst mal – der Mandant war einverstanden – mit dem bisherigen Anwalt. Doch was der Mandant über die Ursache des Konflikts erzählte, traf zu. „Ich gebe den Mandanten grundsätzlich keine Kopien von Ermittlungsakten“, sagte mir der Anwaltskollege. „Ich bespreche den Inhalt der Akte mit dem Mandanten, er darf in meiner Gegenwart auch mal die wichtigsten Stellen lesen, aber eine Kopie gibt es bei mir grundsätzlich nicht.“
Eine richtige Begründung für diese Praxis wollte mir der Kollege nicht geben. Außer natürlich, dass er das schon immer so macht. Seitdem er als Anwalt zugelassen ist, was immerhin 15 Jahre sind. Was er ansonsten sagte, klang so, als wolle er er sich ein gewisses Herrschaftswissen gegenüber dem eigenen Auftraggeber sichern. Nach dem Motto: Ich bin der Anwalt, lass mich arbeiten, stell‘ am besten gar keine Fragen. Damit war er bei dem aktuellen Mandanten aber an den falschen geraten.
Der Betroffene fragte sich völlig zu Recht, wie er seinen Anwalt informieren und mit ihm gemeinsam eine Strategie entwickeln soll, wenn er gar nicht exakt weiß, was gegen ihn vorliegt. Dazu müsste er ja die Ermittlungsakte kennen. Denn nur aus dem Akteninhalt von Seite 1 bis zum Ende ergibt sich der Tatvorwurf.
Ich nehme vorweg, die beiden fanden nicht mehr zusammen. Ich habe das Mandat also übernommen und bin so vorgegangen, wie ich es regelmäßig tue. Ich besorgte die Ermittlungsakte. Der Mandant kriegte von mir eine Kopie aller Unterlagen. So konnte er selbst lesen, was was ihm zur Last gelegt wird und welche Beweismittel es gibt. Anschließend konnten wir auf Augenhöhe besprechen, wie wir ihn rausholen.
Ab und zu gibt es aber tatsächlich Fälle, in denen komplette Offenheit gegenüber dem Mandanten sich nicht verwirklichen lässt. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn ich begründeten Anlass zur Sorge haben muss, dass der Mandant die Informationen missbrauchen wird. Um Zeugen zu bedrohen etwa. Oder für Verdunkelung.
Besonders heikel ist es, wenn sich aus der Akte ergibt, dass gegen den Mandanten ein Haftbefehl besteht. Oder dass eine Durchsuchung ansteht. Dann muss ich abwägen. Ich frage dann, ob ich die Informationen auf „ordentlichem“ Wege erhalten habe. Kann man mir keine Trickserei vorwerfen, gehen im Zweifel die Interessen des Mandanten vor.
Aber solche Probleme stellen sich echt nur in ein, zwei Prozent der Fälle. Ansonsten kriegt der Mandant alle Unterlagen, die ich erhalte. Ich persönlich würde es ja auch befremdlich finden, wenn mich mein eigener Anwalt teilweise im Dunkeln lassen würde. Der einzige Strafverteidiger, den ich bisher in meinem Leben brauchte, hat es aber zum Glück so gehalten wie ich.