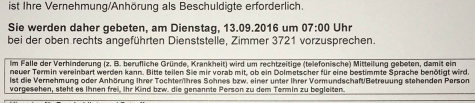Wer gelegentlich mal einen Joint raucht und trotzdem mit dem Auto unterwegs ist, hat es deutlich schwieriger als ein Alkoholkonsument. Auch nach einem ausgiebigen Zechgelage kann man nach 24 Stunden sicher sein, dass der Promillewert null sein wird. Oder zumindest nicht mehr im nennenswerten Bereich. Bei Marihuana ist das keineswegs der Fall, wie jetzt mal wieder ein Mandant feststellen musste.
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mandant nachts rausgewinkt. Die Blutprobe ergab einen THC-Gehalt von knapp 2 ng/ml. Und das, obwohl der Mandant sich sicher war, dass er mindestens 72 Stunden rein gar nichts mehr geraucht hatte. Trotzdem reichten die chemischen Nachwirkungen noch locker, um den sogenannten analytischen Grenzwert von 1 ng/ml zu übersteigen.
Früher hätte man nicht mal im Traum denken können, so niedrige THC-Konzentrationen mit vertretbarem Aufwand nachweisen zu können. Dank des rasanten Fortschritts der Analysetechnik lassen sich heute auch weit geringere Spuren belegen. Der „analytische Grenzwert“ ist deshalb eher eine juristische Absicherung nach unten, weniger eine technische Notwendigkeit.
Ab 1 ng/ml dem gibt es bei uns bereits ein Fahrverbot von einem Monat, 500 Euro Geldbuße und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei. Jedenfalls bei Bußgeldrichtern, die nicht vom Bußgeldkatalog abweichen. Das sind die allermeisten. Und das ganz dicke Ende kommt dann ohnehin erst noch später: Das Straßenverkehrsamt lädt im besten Fall zum Drogenscreening, im ungünstigsten zum kompletten Idiotentest.
Dabei hätte der Mandant sogar noch eine realistische Chance gehabt, ungeschoren davon zu kommen. Dazu hätte er aber einiges auf keinen Fall nicht mit sich machen lassen dürfen. Nämlich dem Polizeibeamten erlauben, dass er ihm in die Augen leuchtet, was zu der Feststellung „erweiterte Pupillen“ führte. Ebenso wenig hätte er sich dazu äußern müssen, ob er einen trockenen Mund hat.
Gut, gegen die weitere Feststellung „fahle Gesichtsfarbe“ konnte der Mandant sich kaum wehren. Spätestens da hätte er aber jede Kooperation einstellen sollen. Die Beamten waren ja – auch weil mein Mandant im Straßenverkehr nicht aufgefallen war – auf der Suche nach Ausfallerscheinungen oder körperlichen Symptomen, die auf Betäubungsmittelkonsum hindeuten.
Den schwerwiegendsten Fehler machte der Mandant, als ihn der Polizeibeamte um einen „Drogenvortest“ bat. Diese Tests gibt es in verschiedenen Varianten. Entweder wird ein spezielles Papier über die Stirn gewischt. Oder der Betroffene wird überredet, in einen Plastikbecher zu pinkeln, damit der Beamte einen Teststreifen in den Urin halten kann.
Zur Mitwirkung an beiden Tests ist man nicht verpflichtet. Die Polizei kann auch nichts erzwingen, auch wenn vor Ort gerne mal was anderes behauptet wird. Wer den Test verweigert, nimmt nur seine Rechte wahr. Für den Mandanten hätte es in diesem Augenblick im Fall seiner Weigerung noch die Chance gegeben, dass die Beamten ihn doch nicht als lohnendes Objekt betrachten. Denn einen Verdächtigen bei unklarer Lage mit auf die Wache zu nehmen, kostet Zeit und später auch Geld. Den Polizeiarzt und die Blutanalyse zahlt dem Staat bei „0,0“ keiner.
Jeder Beamte wägt also sehr sorgfältig ab, ob er einen Wackelkandidaten mit auf die Wache nimmt. Gut möglich, dass er sich für ein „Gute Fahrt noch“ für den Betroffenen entscheidet – der nächste Verdächtige ist ja in der Regel nur einen Kellenwink entfernt.
Indem der Mandant aber brav in das Töpfchen pieselte, nahm er sich natürlich diese realistische Chance. Deshalb kann ich auch anlässlich dieses Falls nur noch mal darauf hinweisen, dass man sich bei einer Verkehrskontrolle schon prophylaktisch am besten dadurch verteidigt, indem man jedwede Mitwirkung und möglichst auch eine Befragung konsequent verweigert.
Nur so wahrt man sich die Chance, vielleicht doch weiterfahren zu dürfen. Ein schlechtes Gewissen muss man sich dafür von niemandem einreden lassen. Rechte sind nun mal dafür da, dass man sie nutzt.