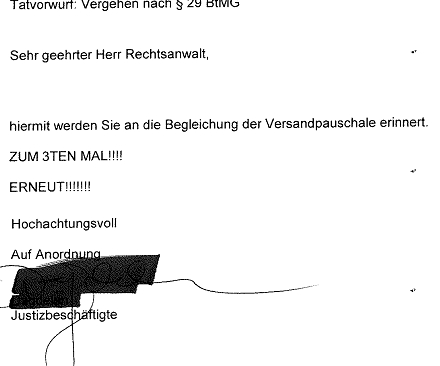„Knöllchen-Horst“ muss die Dashcams in seinem Auto ausschalten. Der Massendenunziant, der über die Jahre mehr als 50.000 Anzeigen gegen andere Verkehrsteilnehmer gestellt haben soll, erhielt eine entsprechende Untersagungsverfügung von der niedersächsischen Datenschutzbeauftragten. Das Verwaltungsgericht Göttingen bestätigte nun im Eilverfahren das Dashcam-Verbot.
Knöllchen-Horst hatte auch eine Vielzahl von Anzeigen erstattet, in denen er auch Aufnahmen seiner Dashcams als „Beweis“ vorlegte. Das geschah auch, nachdem ihn die Datenschutzbeauftragte aufgefordert hatte, die private Verkehrsüberwachung einzustellen. In den weitaus meisten Fällen zeigte Knöllchen-Horst Verkehrsverstöße an, bei denen er selbst gar nicht beeinträchtigt wurde.
So eine pädagogisch motivierte, dauernde Verkehrsüberwachung aus dem eigenen Auto heraus verstößt laut dem Gericht eindeutig gegen den Datenschutz. Knöllchen-Horst durfte deshalb ein Zwangsgeld von 1.000 Euro angedroht werden, wenn er weiter mit angeschalteter Dashcam durch die Gegend fährt. Ob eine „normal“ genutzte Dashcam, bei der Aufnahmen zum Beispiel schnell wieder überschrieben werden, zulässig ist, musste das Gericht nicht entscheiden (Aktenzeichen 1 B 171/16).