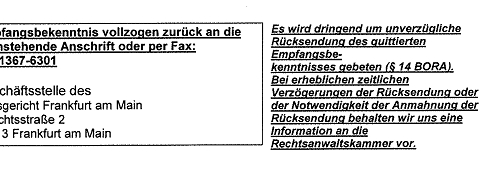Heute ist für einen meiner Mandanten eine Welt zusammengebrochen. Und ich war schuld. Oder sagen wir, ich war der Überbringer der traurigen Botschaft. Für die ich allerdings nun wirklich nichts kann.
Mein Mandant fühlte sich – zu Recht – als Opfer eines tätlichen Angriffs. Zum Glück ist nicht viel passiert. Deshalb geht es auch insgesamt in Ordnung, dass die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Amtsgerichts das Ermittlungsverfahren gegen den Bechuldigten einstellte. Und zwar gegen Zahlung einer Auflage von einigen hundert Euro. Immerhin.
Aber selbst wenn die Einstellung nicht in Ordnung ginge, müsste der Mandant damit leben. Gegen die Einstellung nach § 153a StPO mit einer Auflage für den Beschuldigten hat der Geschädigte kein Rechtsmittel. Im Gegensatz zu einer Einstellung mangels Tatverdachts.
Was den Mandanten aber wirklich aufregte, war folgendes: Der Beschuldigte hatte in einer schriftlichen Stellungnahme den Sachverhalt schön verdreht, fleißig Ausflüchte gebraucht und sich insgesamt als Unschuldslamm dargestellt. Alles falsch, fand der Mandant. Fand übrigens auch der Staatsanwalt, sonst hätte er dem Angeklagten ja keine Auflage gemacht. Was den Mandanten aber enorm ärgerte war der Umstand, dass der Beschuldigte nicht auch für seine „Falschaussage“, die den Mandanten in einem schlechteren Licht dastehen lassen, zur Rechenschaft gezogen wird.
Ich habe dem Mandanten erklärt, dass ein Beschuldigter nicht zur Wahrheit verpflichtet ist. Vielmehr kann er bedenken- und folgenlos lügen. Jedenfalls so lange, wie er nicht andere zu Unrecht beschuldigt. Das könnte dann strafbar sein, etwa als falsche Verdächtigung (§ 164 StGB). Außerdem geht ein Beschuldigter bei schwereren Vorwürfen das Risiko ein, dass er einen Grund für Untersuchungshaft gegen sich zimmert. Stichwort: Verdunkelungsgefahr.
Aber ansonsten ist es eben das Privileg des Beschuldigten, dass er lügen darf. (Gleichzeitig ist das auch ein Fluch, denn schon deshalb wird ihm in der Praxis viel weniger geglaubt.) Aber der Rechtsstaat will das halt so. Das habe ich auch dem Mandanten erklärt. Der allerdings blieb dabei, dass nun eine Welt für ihn zusammenbricht. Womit er wohl meinte, dass er mir das alles jetzt mal nicht so recht glaubt und hofft, dass seine Welt weiter heile ist.
Gut möglich, dass er sich noch mal von einem Anwaltskollegen beraten lässt. Ich bin allerdings guter Dinge, dass der ihm nicht groß was anderes erzählt.