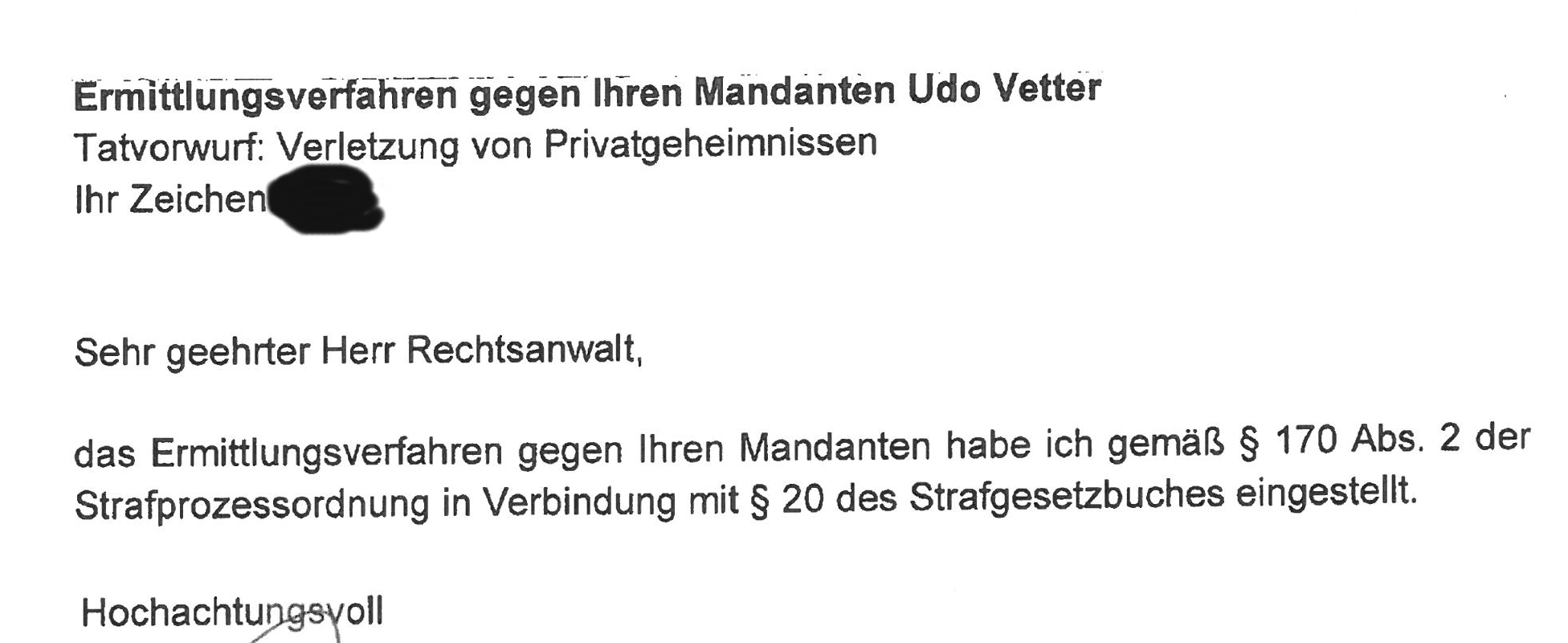Aktuell kocht in den sozialen Medien ein Thema hoch. Der aktuelle Regierungsflug nach Kanada. Vor allem teilnehmende Journalisten haben emsig Schnappschüsse aus dem Jet getwittert. Allerdings trägt auf den Bildern niemand eine Maske. Niemand.
Kritik hieran ist natürlich zwangsläufig, waren ja auch genug Leute in letzter Zeit in Urlaub und wurden im Flugzeug aufgefordert, der Maskenpflicht nachzukommen. Da ist es vielleicht nur semiratsam, wenn etwa die an der Reise teilnehmende Korrespondentin von t-online auf Twitter gewisse Bedenken nicht sachlich aufgreift, sondern mit einem schnodderigen „Funfact für Trolle“ reagiert. Das ist wirklich ihre Wortwahl, nicht meine. Die Journalistin verweist darauf, die Teilnehmer hätten alle PCR-Tests gemacht. Sie sogar einen für deutlich mehr als hundert Euro.
Ich will nicht über Sinn und Unsinn der Maskenpflicht diskutieren. Woran aber kein Weg vorbeiführt: § 28b IfSG (Infektionsschutzgesetz) schreibt in seiner derzeit gültigen Fassung eine Maskenpflicht für alle Flugzeuge fest, die von Deutschland aus starten. Was für Berlin in geografischer Hinsicht, halten wir das als einfachsten Punkt direkt ebenfalls fest, allenfalls im tiefsten Trollistan bestritten wird.
Die Maskenpflicht gilt für „alle Verkehrsmittel des Luftverkehrs“. Unter Luftverkehr fallen alle Dinge, die sich unter Leugnung der Schwerkraft von A nach B bewegen und die keine Vögel sind. So ein Regierungsflieger sieht auch stark nach einem „Verkehrsmittel“ aus, selbst wenn vielleicht Luftwaffe oder Bundesrepublik Deutschland draufsteht. Die kolportierten Bilder von dem genutzten Flugzeug lassen jedenfalls jedenfalls in der Journalisten-Holzklasse keinen sonderlichen Unterschied zu einem Lufthansa-Flieger erkennen. Das Infektionsschutzgesetz gilt ganz eindeutig auch für die Bundeswehr. Das steht ausdrücklich in § 54a IfSG, wonach die Bundeswehr selbst für den Vollzug des Gesetzes zuständig ist.
Schauen wir nach anderen validen Argumenten, welche bestätigen könnten, dass die Leute, die das Ganze einfach mal hinterfragen, dann doch nur Dösbaddel sind. Ein valides Argument gibt es für die Regierungsflieger. Es wird nämlich gesagt, es handele sich ja nicht um einen „öffentlichen“ Flug.
Dazu muss man das Gesetz sehr genau lesen. Darin heißt es:
Die Verkehrsmittel des Luftverkehrs und des öffentlichen Personenfernverkehrs dürfen von Fahr- oder Fluggästen sowie dem Kontroll- und Servicepersonal und Fahr- und Steuerpersonal nur benutzt werden, wenn diese Personen während der Beförderung eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Schutz) tragen.
Das Gesetz unterscheidet als zwischen „öffentlichem Personenfernverkehr“ und „Verkehrsmitteln des Luftverkehrs“. Bei letzteren steht das Wort öffentlich gerade nicht. Schon daraus lässt sich sehr deutlich entnehmen, dass der Gesetzgeber sogar bewusst unterscheiden wollte, und zwar so: Maskenpflicht im Personenfernverkehr nur, wenn er öffentlich ist. Maskenpflicht im Flugverkehr, wenn Flugverkehr. Also wird es jedenfalls nichts mit dem Rettungsanker nichtöffentlich.
Auch ein PCR-Test ändert an der Maskenpflicht übrigens nichts, wie man zum Beispiel beim ADAC nachlesen kann und was auch die Lufthansa, die ja den Maskenfrust als Carrier täglich abbekommt, in ihren Verlautbarungen immer wieder betont. Es gibt keine Regelung für den Luftverkehr, welche die Maskenpflicht aufhebt, es sei denn man ist (körperlich) jünger als sechs Jahre oder gesundheitlich beeinträchtigt. Ein Ablasshandel PCR-Test statt Maske findet juristisch nicht statt.
So weit meine rechtliche Bewertung zum maskenlosen Flug des Regierungsfliegers. Aber es gilt ja der Grundsatz zwei Juristen, drei Meinungen. Vermutlich wird sich ohnehin das Berliner Gesundheitsamt und später das Amtsgericht mit vielen, vielen Einzelfällen beschäftigen dürfen. Der Verstoss gegen die Maskenpflicht von in Deutschland gestarteten Flügen ist ein Bußgeldtatbestand und kann entsprechend geahndet werden.