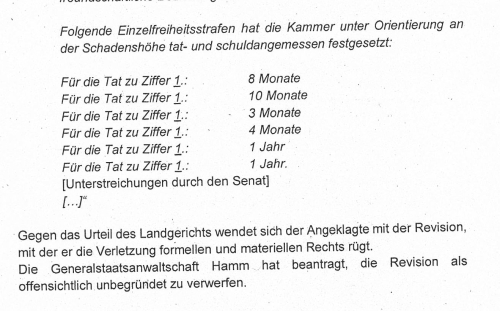Wohnungsmieter müssen meist die Hausmeisterkosten tragen. Wie weit die Verpflichtung allerdings wirklich reicht, musste jetzt der Bundesgerichtshof klären. Die Mieter im entschiedenen Fall sollten nämlich auch eine „Notdienstpauschale“ dafür zahlen, dass der Hausmeister außerhalb der normalen Bürozeiten Schadensmeldungen entgegennimmt und eventuell Fachfirmen beauftragt.
Dafür bekam der Hausmeister insgesamt 1.199,52 € extra pro Jahr. Der betroffene Wohnungsmieter sollte davon 102,84 € tragen. Dazu ist er aber nicht verpflichtet, urteilt der Bundesgerichtshof. Der Notdienst beziehe sich an sich auf normale Verwaltungstätigkeiten. Was sich schon daran zeige, dass während der normalen Öffnungszeiten Schadensmeldungen regelmäßig an die Verwaltung gehen – ohne dass diese den zusätzlichen Aufwand berechnen darf.
Der Notdienst sei damit insgesamt eher der Sphäre des Hauseigentümers zuzuordnen und somit nicht umlagefähig. Diese Klarstellung des Bundesgerichtshofs könnte für viele Mieter bares Geld bedeuten. Sehr viele Gerichte haben in der Vergangenheit nämlich anders entschieden und die Kosten für den Hausmeisternotdienst als umlagefähig angesehen. Das wird nach der Grundsatzentscheidung nicht mehr möglich sein (Aktenzeichen VIII ZR 62/19).