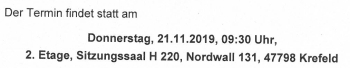Wenn jemand Empfänger einer Postsendung ist – war er dann auch der Besteller? Diese Frage wird von Ermittlern viel zu häufig als überflüssig betrachtet, gerade wenn sie mutmaßlichen Drogenbestellungen über das „Darknet“ nachgehen. Dabei dürfen sie es sich gerade in diesem Punkt nicht zu leicht machen. Dies zeigt das Amtsgericht Dillingen in einer aktuellen Entscheidung auf.
Einem Mann wurde vorgeworfen, über das Darknet 64,40 Gramm Amphetamin und 10,16 Gramm MDMA bestellt und per Post erhalten zu haben. Das Amtsgericht pflückt die sogenannten Beweise auseinander, mit denen die Staatsanwaltschaft den Angeschuldigten überführen wollte:
Der Nachweis eines persönlichen Kontakts zwischen dem Angeschuldigten und dem Versender der abgefangenen Postsendung ergibt sich aus der Akte nicht. Dies ist Betäubungsmittelgeschäften via Darknet in der Regel immanent, ändert jedoch nichts daran, dass insoweit keine Beweismittel aufgefunden wurden. Insbesondere die Auswertung des Telefons des Angeschuldigten ergab keinerlei Hinweise auf den Besuch des Darknets – ja nicht einmal über das Vorhandensein der hierfür notwendigen Software (z.B. TOR-Browser).
Im kriminellen Milieu allgemein und im Rahmen von Betäubungsmitteldelikten im Speziellen ist die Verwendung vom Fremd- und Aliaspersonalien und hierzu gehöriger Adressen keinesfalls unüblich. Auf die Idee, Paketsendungen entsprechend zu bestellen und dann „abzufangen“ kommen entsprechende „Kunden“ häufiger.
Bei der Hausdurchsuchung soll eine „Auflistung mit Bitcoinwährungen“ entdeckt worden sein. Hierzu merkt das Gericht an:
Zum anderen legt die Existenz einer entsprechenden Auflistung keinesfalls Betäubungsmittelgeschäfte nahe. Es sind zahlreiche andere mögliche – legale – Verwendungen denkbar. Kryptowährungen – zu denen z.B. auch „Bitcoin“ gehört – unterlagen im fraglichen Zeitraum einem regelrechten „Boom“ oder „Goldrausch“. Die Kurse entsprechender Währungen überboten sich binnen kürzester Zeit regelmäßig selbst in immer fantastischere (unrealistische)
Höhen, bis es Ende 2018 zum „Crash“ entsprechender Kurse kam.
Kryptowährungen können wie Aktien gehandelt werden, aber auch selbst durch Betreiben entsprechender
„Mining-Programme“ mittels komplexer Rechenaufgaben, zu deren Lösung man „Arbeitszeit“ eigener Computer zur Verfügung stellen konnte, generiert werden. Viele Online-Dienstleister vom Versandhandel bis zum Softwaremarkt akzeptieren und akzeptierten diverse Kryptowährungen als legales Zahlungsmittel.
Nicht einmal der Hinweis der Staatsanwaltschaft auf eine Vorstrafe konnte die Anklage retten:
Auch die Vorahndungen des Angeschuldigten sprechen für sich genommen nicht für eine Tatbeteiligung. Der Angeschuldigte hat zuletzt wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Bewährungsstrafe erhalten. Die Bewährungszeit hat er allerdings durchstanden, die Strafe wurde erlassen. Allein der Umstand, in der Vergangenheit entsprechende Taten begangen zu haben, lässt nicht den Schluss zu, dass er dies auch erneut tun würde.
Die Anklage wurde nicht zugelassen, und das ist auch völlig richtig so (Aktenzeichen 307 Ls 302 Js 122579/18).