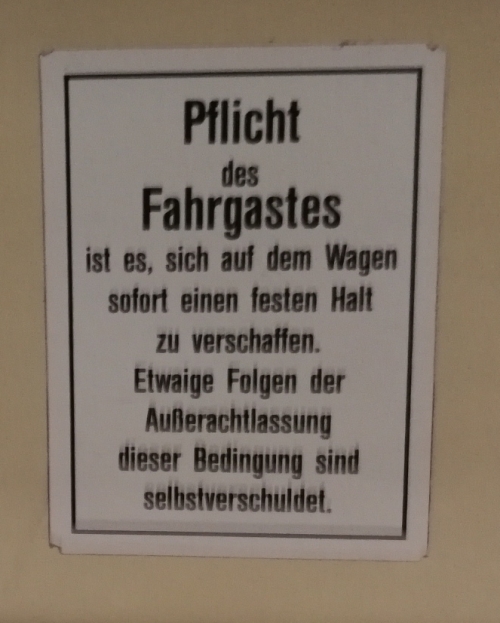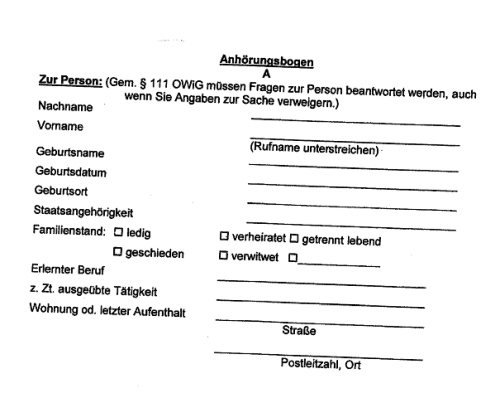Der Fall um den mutmaßlichen Mörder Ali B. hat ja schon einige interessante juristische Facetten hervorgebracht. Die denkwürdige „Rückführung“ aus dem Irak, die eindeutig ohne Zustimmung der zuständigen Regierung in Bagdad erfolgte, scheint nur der Auftakt gewesen zu sein. Jetzt wird bekannt, dass Ali B. weder bei seiner Vernehmung bei der Polizei noch bei seiner Vorführung vor der Haftrichterin einen Verteidiger hatte.
Die Behörden sagen dazu: Wir haben Ali B. über seine Rechte belehrt. Aber er wollte ja keinen Anwalt (Bericht auf Spiegel Online). Das kann man natürlich glauben. Man kann aber auch mal fragen, in was für einer Situation sich Ali B. befunden haben mag. Er wurde auf dubiose Art und Weise im Irak abgeholt, nach Deutschland geflogen, vom SEK vollversorgt – martialische Bilder gibt es hierzu ja einige.
Sicher war Ali B. in der Situation ausgeschlafen, entspannt und in jedem Augenblick in der Lage, die Tragweite der Belehrungen zu verstehen und sich wirklich frei zu entscheiden. Das kann man natürlich glauben. Wer dies tut, braucht eigentlich nicht weiter zu lesen, denn es ist ja alles ganz klar.
Ist es keineswegs. Zunächst mal scheint bei der Erklärung, wieso Ali B. keinen Anwalt beigeordnet erhielt, den Behörden ein kleiner Fehler unterlaufen zu sein. Sie sagen, einen Pflichverteidiger sehe das Gesetz erst ab „Vollzug der Untersuchungshaft“ vor, das heißt nach der Entscheidung der Haftrichterin (seine Aussagen bei der Polizei und der Richterin hat Ali B. natürlich vorher gemacht).
Ja, so war das auch mal, sogar viele Jahrzehnte. Richtig ist aber auch: Das Verfahrensrecht wird quasi im Jahrestakt im Interesse der Verfahrensoptimierung verschärft. Aber zu sehr sollte man sich nicht darauf verlassen, dass alles nur heftiger wird, denn mitunter finden auch sinnvolle Regelungen Eingang ins Gesetz, welche – man glaubt es kaum – die Rechtslage des Beschuldigten verbessern. Die Vorschrift, die uns hier interessiert, ist seit letztem Sommer in Kraft. § 141 Abs. 3 S. 4 StPO lautet nun:
Das Gericht, bei dem eine richterliche Vernehmung durchzuführen ist, bestellt dem Beschuldigten einen Verteidiger, wenn die Staatsanwaltschaft dies beantragt oder wenn die Mitwirkung eines Verteidigers aufgrund der Bedeutung der Vernehmung zur Wahrung der Rechte des Beschuldigten geboten erscheint.
Das ist ganz neu – und anscheinend noch nicht so richtig bekannt. Früher lag die Beiordnung eines Pflichtverteidigers weitgehend im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Stellte diese keinen Antrag (wozu sie natürlich in der Regel keine Lust hat), gab es frühestens mit Beginn der Untersuchungshaft einen Pflichtverteidiger. Nun muss das Gericht aber selbst eine Prüfung vornehmen, wenn die richterliche Vernehmung ansteht. Das heißt, der Ermittlungsrichter muss prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Beiordnung gegeben sind – bevor er mit dem Beschuldigten spricht.
Die einzige Frage, die sich gemäß dem Gesetzeswortlaut bei der Vorführung Ali B.s stellte, war folgende: Ist die Mitwirkung eines Verteidigers aufgrund der Bedeutung der Vernehmung zur Wahrung der Rechte des Beschuldigten geboten?
Der Tatvorwurf lautete auf Mord. Mehr geht ja kaum. Dazu die Art und Weise, wie die deutschen Behörden Ali B.s habhaft geworden sind. Der mediale Druck. Seine offensichtliche Isolation in Deutschland (die Familie soll ja nach wie vor im Irak sein). Wie will man ernsthaft sagen, hier bedurfte es keines Verteidigers?
Aber angeblich hat Ali B. ja total freiwillig auf einen Anwalt verzichtet. Die Frage ist nicht nur, ob das so stimmt, sondern auch, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Laut der neuen Vorschrift muss der Richter eigenständig objektiv bewerten, ob die Mitwirkung eines Verteidigers geboten ist. Er muss dem Beschuldigten dann im Zweifel einen Anwalt beiordnen – möglicherweise sogar gegen dessen Willen.
Ganz so simpel, wie sie in der Presse dargestellt wird, ist die Sache also nicht. Richtig aussagekräftige Entscheidungen zu der neuen Rechtslage gibt es allerdings auch noch nicht. Mein Kollege Detlef Burhoff meint in seinem Blog, der Fall Ali B. werde die Gerichte noch lange beschäftigen. Mit dem Risiko, dass die Sache am Ende „hoch geht“.
Ich stimme zu und ergänze: Das juristische Risiko hätte man sich sparen können, wenn Ali B. sofort einen Verteidiger bekommen hätte. Und aus rechtsstaatlicher Sicht hätte es auch deutlich besser gewirkt.