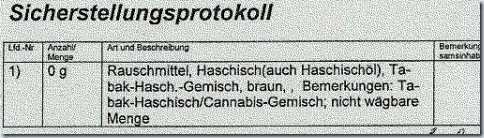Urteile ergehen im Namen des Volkes. Gerichtsverhandlungen sind grundsätzlich öffentlich. Das Volk soll hören dürfen, wie es zu Urteilen kommt. Zur Öffentlichkeit gehört nach meiner Meinung auch, dass sich niemand für den Besuch einer Gerichtsverhandlung rechtfertigen muss. Und auch keine Sorgen zu haben braucht, dass seine Daten irgendwo gespeichert werden.
Die Wirklichkeit sieht mitunter leider anders aus. Zum Beispiel bei einem anstehenden Großverfahren. Da darf nur in den Saal, so das Gericht, “wer seine Personalien (Name, Geburtsdatum und -ort, Anschrift und Ausweisnummer) durch Fertigung von Ablichtungen des Ausweispapiers durch die Justizwachtmeisterei festhalten lässt”. Alle Besucher werden also namentlich erfasst.
Die Gerichte lassen diese Kontrollen mittlerweile zu. Allerdings meist nur unter der Bedingung, dass die Besucherdaten getrennt von den Gerichtsakten erfasst werden. Außerdem müssen sie zeitnah zum jeweiligen Sitzungstag wieder gelöscht werden. Die Erfassung dient nämlich offiziell nur dazu, eventuelle Störer zu identifizieren.
Ob die Besucherlisten tatsächlich gelöscht werden, ist eine andere Frage. Ebenso, ob Polizeidienststellen oder Geheimdiensten gestattet wird, sich vor der Löschung Kopien zu machen. Selbst wenn alles korrekt abläuft, bleibt der Umstand, dass man sich als Zuschauer ausweisen muss. Das schreckt den einen oder anderen auf jeden Fall ab. Ich bezweifle, dass man da noch von echter Öffentlichkeit sprechen kann.
Hier mal der komplette Text einer ganz frischen “sitzungspolizeilichen Verfügung”:
Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in der Hauptverhandlung gemäß § 176 GVG wird folgendes angeordnet:
1. Zum Sitzungssaal wird nur zugelassen, wer
a) sich durch einen gültigen Bundespersonalausweis, Reisepass, Führerschein, oder vergleichbare ausländische Ausweispapiere ausweisen kann,
b) seine Personalien (Name, Geburtsdatum und -ort, Anschrift und Ausweisnummer) durch Fertigung von Ablichtungen des Ausweispapiers durch die Justizwachtmeisterei festhalten lässt,
c) sich einer Durchsuchung seiner Person und der mitgebrachten Sachen
unterzieht,d) keine der unter 2.c) genannten Gegenstände beim Betreten des Gerichtssaals mit sich führt,
e) nicht als Zeuge in der Anklageschrift/Zeugenliste benannt ist oder dessen Zeugenvernehmung abgeschlossen ist.
2.
a) Die Einlasskontrolle erfolgt vor dem Eingang des Sitzungssaales.
b) Die Durchsuchung ist durch die Justizwachtmeister und Justizwachtmeisterinnen vorzunehmen.
Die Durchsuchung geschieht elektronisch und bei Bedarf durch Abtasten über der Kleidung. Bei Trägern von Mänteln und Jacken sind zunächst diese, nach deren Ablegen ist die darunter befindlichen Oberbekleidung/Bekleidung abzutasten.
In die Untersuchung sind auch das mitgeführte Handgepäck und Aktentaschen, Damenhandtaschen und sonstige Behältnisse einzubeziehen. Männliche Besucher werden nur von Wachmeistern, weibliche nur von Wachtmeisterinnen durchsucht.
c) Die Durchsuchung richtet sich auf
– Waffen und sonstige gefährliche Gegenstände, die zur Verletzung einer Person geeignet sind,
– für Bild- und Tonaufnahmen geeignete Geräte wie Mobiltelefone und Notebooks/Laptops.
Diese Gegenstände sind vor Betreten des Sitzungssaals den Justizwachtmeistern/innen zur Verwahrung zu übergeben. Wird die Übergabe verweigert, ist der betreffende Besucher zurückzuweisen.
3. Die vorgenannten Einschränkungen gelten auch für Terminsunterbrechungen und Pausen und auch beim erneuten Betreten des Sitzungssaals.
4. Von der Einlasskontrolle, der Durchsuchung und den Einschränkungen zu 1.) sind ausgenommen:
– die Mitglieder des Gerichts, Protokollführer, Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, die Verteidiger und die Vertreter der Jugendgerichtshilfe,
– die sich als Polizeibeamte ausweisende -oder als solche bekannte-
Personen; diesen wird gestattet, ihre Dienstwaffen im Sitzungssaal zu
tragen.5. in allen Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Vorsitzenden oder seines Vertreters einzuholen.
Trotz der Liebe zum Detail verliert das Gericht kein Wort darüber, wann die Daten und Personalausweiskopien der Besucher gelöscht werden. Ein paar Worte dazu wären aber eigentlich angebracht.