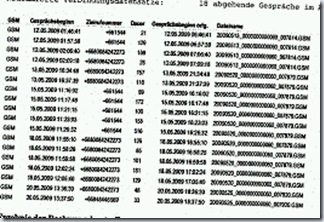Wir haben hier im Büro einen kleinen Fall, der aber technisch interessant ist. Es geht um Roaminggebühren, also ein stetes Ärgernis für Urlauber.
Die Geschichte ergibt sich aus unserer Klageerwiderung, die ich nachfolgend einfach mal wiedergebe. Ich bin gespannt, wie die Leser die Sache einschätzen.
Unser Brief ans Gericht:
In Sachen
m. GmbH ./. K.
beantragen wir, die Klage abzuweisen.
Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin steht der geltend gemachte Zahlungsanspruch nicht zu.
Die Parteien streiten im Ausgangspunkt um 142,40 Euro brutto. Es handelt sich um Telefongebühren, die der Beklagte angeblich verursacht haben soll, als er über die bei der Klägerin gebuchte Handynummer von Thailand aus telefoniert haben soll.
Es ist richtig, dass der Beklagte im Urlaub in Thailand über den Telefonanschluss mit seinem Handy telefoniert hat. Jedoch hat die thailändische Telefonfirma AIS, die für die Klägerin das Roaming betreibt, diese Gespräche unrechtmäßig berechnet, denn der Beklagte nutzte eine sogenannte „Calling Card“.
Im einzelnen:
Da Gespräche mit einer deutschen Handynummer in Thailand sehr teuer sind, erwarb der Beklagte eine Calling Card des Anbieters CAT. Hierbei handelt es sich um vorbezahltes Telefonguthaben.
Beweis: Kopie der Calling Card nebst Anleitung; Anlage B 1.
Das Guthaben wird abtelefoniert, indem der Nutzer in Thailand zuerst eine kostenfreie Rufnummer des Anbieters CAT anruft. Ist er mit dem Anbieter CAT verbunden, gibt der Kunde eine PIN-Nummer sowie die eigentliche Rufnummer an, die er erreichen will. Er wird dann quasi intern von CAT durchgestellt, während der Anruf bei CAT selbst kostenlos ist. Die Kosten für das eigentliche Gespräch bucht CAT vom Guthaben der Calling Card ab.
Die Zugangsnummer für den Beklagten zu CAT lautete entweder 1544 oder 001-800-84242273. Dies ist ausdrücklich so auf der Anleitung der Calling Card vermerkt, und zwar unter Ziff. 1 (mit Kreuzchen gekennzeichnet).
Die Klägerin bestätigt dies sogar selbst, wie sich aus ihrem Schreiben vom 25. Juni 2009 an den Beklagten nebst angehängtem Bericht über die Rechnungskontrolle ergibt. In der Mitte ihres Schreibens erklärt die Klägerin selbst, welche Nummern der Beklagte zu wählen hatte.
Beweis: Schreiben nebst Rechnungsprüfbericht; Anlage B 2.
Genau diese Nummern hat der Beklagte auch bei den streitigen Telefonaten von Thailand aus vorgewählt.
Beweis: Zeugnis der Ehefrau des Beklagten.
Die Ehefrau des Beklagten kann dies bezeugen, weil die Telefonate in die Heimat stets gemeinsam vom Pool aus geführt wurden. Das Display des (alten) Urlaubshandys war klein, so dass die Ehefrau des Beklagten diesem stets die Einwahlnummern von CAT, den PIN-Code und die eigentliche Rufnummer diktierte.
Keinesfalls hat der Beklagte den Rufnummern, wie nun von der Klägerin behauptet, die Landesziffer +66 vorangestellt.
Beweis: Zeugnis der Ehefrau des Beklagten.
Bei der +66 handelt es sich um die Landesvorwahl von Thailand. Es ist höchst lebensfremd, dass jemand, der in Thailand ist und per Roaming in ein thailändisches Handynetz eingebucht ist, der Telefonnummer für eine Calling-Card die Landesvorwahl voranstellt. Dies gilt umso mehr, als auf der Anleitung ja die Landesvorwahl auch keineswegs aufgeführt ist. Der Beklagte hatte also gar keinen Grund, die +66 vorzuwählen.
Unabhängig davon ist aber aus dem Rechnungsprüfbericht, der zur Anlage B 2 gehört, sehr schön zu erkennen, dass der Beklagte genau die Einwahlnummern für die Calling Card verwendet hat. Die streitigen Gespräche waren alle an die Einwahlnummern gerichtet.
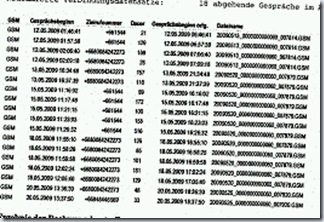
Da es sich – unstreitig – um eine kostenlose Einwahlnummern handelt, hätten diese Gespräche schlicht nicht berechnet werden dürfen.
Sollte die Klägerin bestreiten, dass die Einwahlnummern kostenlos sind, wird hierfür Beweis angetreten durch Sachverständigengutachten.
Als Beleg füge ich außerdem einen aktuellen Ausdruck der Internetseite von CAT bei. Hieraus ergibt sich, dass die schon seinerzeit verwendeten Rufnummern nach wie vor aktuell sind. Es handelt sich um kostenfreie Rufnummern, wie auf der Webseite von CAT (www.thaitelephone.com) nachzulesen ist. Das gilt auch für Anrufe von Mobiltelefonen aus.
Da der Kläger die korrekte Einwahlnummer verwendet hat, kann es sich allenfalls um ein technisches Versehen der Telekommunikationsfirma AIS handeln, mit der die Klägerin in Thailand Roaming anbietet.
Aus dem Prüfbericht ist ja auch ersichtlich, dass der Beklagte bei CAT angerufen hat. Er wurde auch ordnungsgemäß mit CAT verbunden und konnte dann seine Heimatgespräche nach dem dargelegten Prozedere führen. Diese Gespräche wurden auch der Calling Card des Beklagten entsprechend belastet.
Soweit sich die Klägerin lediglich darauf bezieht, der Beklagte habe die Ländervorwahl +66 mitgewählt, ist dies nicht zutreffend, wie unter Beweis gestellt.
Überdies kann die Verwendung einer korrekten Ländervorwahl grundsätzlich nicht dazu führen, dass sich an dem Tarif für ein Gespräch etwas ändert. Da sich der Beklagte ohnehin über den Roaming-Partner der Klägerin in ein thailändisches Mobilfunknetz eingebucht hatte, begannen alle von ihm abgehenden Gespräche ohnehin in Thailand. Die Hinzufügung der +66 wäre also allenfalls unbeachtlich, da die +66 genau in jenes Netz führte, in dem sich der Beklagte mit seinem Handy bereits befand.
Ein Anruf aus dem deutschen Handy- oder Festnetz zu der (fiktiven) Rufnummer 089/567890 in München wird ja auch nicht dadurch teurer, dass der Anrufer +4989567890 wählt, dem Anruf also die internationale Vorwahl für Deutschland voranstellt.
Beweis: Sachverständigengutachten.
Sollte dies bei dem Roaming-Partner der Klägerin anders sein, läge ein Tarifierungs- oder Softwarefehler vor. Für derart vertragswidriges Verhalten muss der Beklagte aber nicht bezahlen, da derartige Gebühren zu Unrecht berechnet würden.
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch nicht der Beklagte in der Beweislast dafür, dass die Gebührenansprüche nicht entstanden sind. Vielmehr muss die Klägerin beweisen, dass der Beklagte gebührenpflichtige Gespräche geführt hat. Dies liegt zum einen daran, dass die Klägerin hier Ansprüche geltend macht, die ihr ein ausländischer Kooperationspartner mitteilt (Roaming). Hier spricht noch nicht einmal der erste Anschein für Richtigkeit der berechneten Gebühren.
Überdies hat der Beklagte genug tatsächliche Umstände dargetan, warum die von ihm geführten Gespräche nicht gebührenpflichtig waren. In der Tat wird ja auch die Klägerin kaum unterstellen wollen, dass der Beklagte im Urlaub beim Calling-Card-Anbieter CAT einfach nur so zum Spaß anruft und absichtlich hunderte Gebühreneinheiten auflaufen lässt.
Der Klägerin stehen die Gesprächsgebühren also nicht zu. …