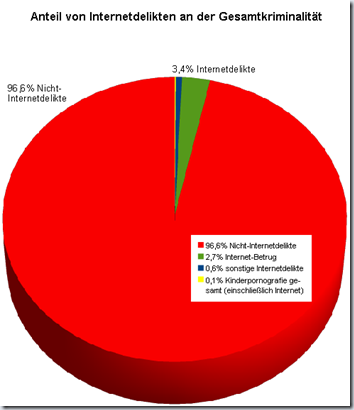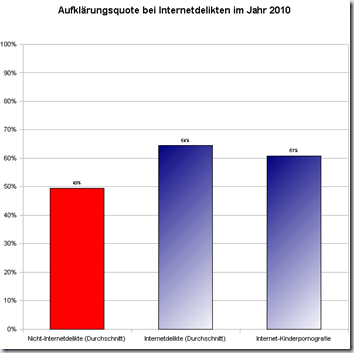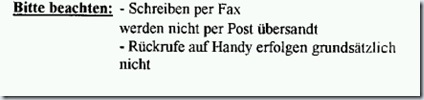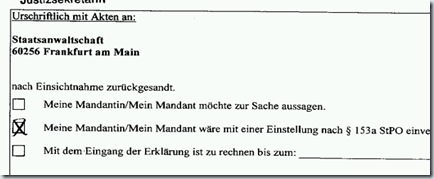Amtsrichter, die als Eil- oder Ermittlungsrichter eingesetzt werden, leben gefährlich. Sie können für grob fahrlässige oder gar vorsätzliche Fehlentscheidungen persönlich in Anspruch genommen werden – und haften dafür mit ihrem Privatvermögen. Eine Erkenntnis, die für viele Bereitschaftsrichter neu sein dürfte. Dementsprechend sorgt sie derzeit auch für Verunsicherung auf Gerichtsfluren.
Dabei können Richter an sich davon ausgehen, dass ihnen erst mal keiner was kann. Allgemein sehen sie sich durch das “Spruchrichterprivileg” geschützt, welches sich in Art. 34 Grundgesetz in Verbindung mit § 839 Absatz 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch findet. Danach kann ein Richter nur dann persönlich zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sein Verhalten eine Straftat ist. Für bloße Fehler, egal ob vorsätzlich oder fahrlässig begangen, haftet ausschließlich der Staat, bei dem der Richter angestellt ist.
Die Tücke steckt allerdings im Detail. Das geltende Recht schließt die persönliche Haftung des Richters nur für “Urteile” aus. Bereitschaftsrichter bereiten aber gar keine Urteile vor, sondern treffen nur unaufschiebbare Anordnungen für das spätere Gerichtsverfahren. Somit gibt es kein absolutes Haftungsprivileg für Haftbefehle, Blutprobenanordnungen, Durchsuchungs- und Unterbringungsbeschlüsse sowie für viele andere Eilentscheidungen, die mitunter ganz erheblich in die Rechte der betroffenen Bürger eingreifen.
Ins Bewusstsein gebracht hat dies Stefan Caspari, Präsidiumsmitglied des Deutschen Richterbundes. In der Dezemberausgabe der Deutschen Richterzeitung stellt er die Rechtslage eingehend (und bislang unwidersprochen) klar und zeigt die persönlichen Risiken für Eil- und Untersuchungsrichter auf.
Als Beispiel nennt Caspari einen fehlerhaften Durchsuchungsbeschluss, der zur Beschlagnahme von Geschäftsunterlagen und der Firmen-EDV führt:
Sollte … eine Sicherstellung dieser Gegenstände erfolgen, kann bereits in den wenigen Tagen … ein erheblicher Vermögensschaden für den betroffenen Betrieb entstanden sein, den persönlich ersetzen zu müssen der Ermittlungsrichter Gefahr läuft.
Es liege auch nahe, dass zu Unrecht Verhaftete Verdienstausfall und Schmerzensgeld einklagen. Wer zu Unrecht zu einer Blutprobe gezwungen werde, könne nicht nur die Frage der Körperverletzung thematisieren, sondern auch eine Entschädigung für die erlittene “Schmach” geltend machen. Zum Alltagsgeschäft der Richter gehören auch Einweisungen in die Psychiatrie. Eine krasse Fehleinschätzung von Eigen- oder Fremdgefährdung dürfte ebenfalls erhebliche Ersatzansprüche auslösen können.
Caspari warnt die Richter ausdrücklich vor Gelassenheit. Sie dürften sich keinesfalls darauf verlassen, dass mögliche Fehler nicht auf sie zurückfallen. Eine falsche Entscheidung eröffne nun mal die “Haftung dem Grunde nach”. Bei entsprechend schweren Beeinträchtigungen der Betroffenen sei es auch keineswegs ausgemacht, dass die dann zuständigen Gerichte die Schwelle zum Schadensersatz unüberwindlich gestalten. Hierzu zitiert der Autor auch Urteile von Verwaltungsgerichten, die Ermittlungsrichtern ein “Verschulden” attestieren. Genau das reicht nach geltender Rechtslage aber für die persönliche Haftung aus.
Allerdings können Betroffene fehlerhaft arbeitende Ermittlungsrichter nicht selbst verklagen. Sie müssen ihre Ansprüche stets beim Land geltend machen. Das Land hat im Falle einer Verurteilung aber die Möglichkeit (und gegebenfalls auch die Pflicht), den Richter persönlich in Regress zu nehmen. Caspari, selbst Richter, macht zwischen den Zeilen deutlich, dass sich Richter keinesfalls darauf verlassen sollten, dass ihr Dienstherr schon nicht an sie herantreten wird. So ein Rückgriff sei jedenfalls “nicht unwahrscheinlich”. Insbesondere in Zeiten knapper Kassen, möchte man anfügen.
Caspari sieht die Ermittlungsrichter ohnehin unter erhöhtem Druck. Die Arbeitsbelastung sei nicht nur hoch, sie steige auch durch immer mehr Verfahren, in denen der Richter ohne Kenntnis von Unterlagen telefonisch entscheiden soll, zum Beispiel bei Blutproben oder Durchsuchungen. Der Autor rät daher seinen Kollegen:
Der … Ermittlungsrichter sollte sich jedoch auch in diesen Fällen, in denen die Dringlichkeit seiner Entscheidung von den beantragenden Personen besonders betont wird, die Zeit zu sorgfältiger Prüfung und Abwägung zu nehmen.
Dabei sollte er nicht nur bedenken, dass dies seine dem Betroffenen gegenüber obliegende Pflicht ist, sondern auch berücksichtigen, dass er im Fall voreiliger, sich im Nachhinein als fehlerhaft und unvertretbar erweisender Entscheidungen für dadurch verursachte Schäden möglicherweise persönlich haftet.
Beim Land NRW, wo wir nachgefragt haben, gibt man sich gelassen. Das Problem sei „selbstverständlich bekannt“. Aber sind die Richter im Lande gesondert darüber informiert? Nein. Das Ministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, “dass den Richterinnen und Richtern die Rechtslage und die hierzu ergangene Rechtsprechung bekannt sind“.
Reiner Lindemann, Vorsitzender des Richterbundes NRW, hält dagegen: “Ich glaube nicht, dass den meisten Kollegen die Problematik bewusst ist.” Auch er sieht unkalkulierbare Haftungsrisiken für alle Eil- und Untersuchungsrichter. Sein dringender Rat an die 2.027 Amtsrichter allein in NRW: “Wer noch keine Diensthaftpflichtversicherung hat, sollte die jetzt abschließen.“ (pbd/U.V.)